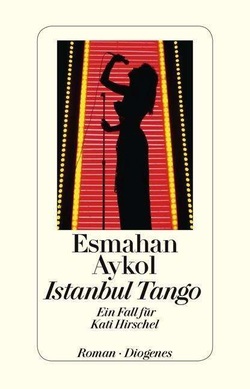 Bei Diogenes ist gerade Esmahan Aykols neuer Krimi "Istanbul Tango" erschienen, der vierte Fall für Kati Hirschel. Aus diesem Anlass hier noch einmal mein Artikel über die Istanbuler Underground Szene, in dem sie porträtiert wird. Ebenso wie Perihan Mağden, über die man in letzter Zeit auch wieder viel hörte. Denn sie hat dasselbe Problem wie Jan Böhmermann: Staatspräsident Erdoğan verklagte sie wegen Beleidigung. In einem Magazin hatte sie geschrieben, Erdogan verhalte sich "wie ein in die Enge getriebenes wildes Tier". Istanbul Underground: Esmahan Aykol, Perihan Mağden und Mehmet Murat Somer Fotos von Ralf Schultheiss Der Papagei hat eine schwere Persönlichkeitsstörung. Man hört ihn bereits, wenn man das "Büyük Londra" betritt: Sein Miauen zerreisst einem das Herz. Empört schaue ich mich in der Lobby um, auf der Suche nach dem Tierquäler, der den Kater am Schwanz zieht, mindestens. Nichts. Kein Tierquäler, kein Kater. Nur eine rotplüschige Bar. Kronleuchter mit Energiesparbirnen, die dem orientalisch angehauchten Jugendstil-Ambiente einen modernen, wenn auch etwas eigenwilligen Charme verleihen. Sitzgruppen im Empire Stil, knarrende Dielen unter roten Teppichen, Tische und Regale aus dunklem Holz, vollgestopft mit Antiquitäten. Einer der anderen Gäste zeigt auf einen Vogelkäfig. Tatsächlich, daher kommt das Gezeter, direkt aus dem Schnabel eines Graupapageis. Ein Vogel, der sich für eine Katze hält. Kann es eine bessere Einstimmung geben auf diesen Ort der Gegensätze, zwischen Ost und West, Europa und Asien, zwischen traditionellen Türken und junger Szene? Im Büyük Londra oder "Grand Hotel de Londres" hat schon Hemingway gewohnt, die pittoreske rote Lobby und eins der etwas abgerockten Zimmer können Sie in Fatih Akins preisgekröntem Film "Gegen die Wand" sehen, der zum Teil hier gedreht wurde. Von hier aus werde ich zu meinen Treffen mit drei Schriftstellern aufbrechen. Autoren und Autorinnen, die eine etwas andere, möglicherweise aktuellere Sicht auf ihre Heimatstadt haben als der alles überstrahlende Orhan Pamuk in seinen "Erinnerungen an eine Stadt"[1]. In den Büchern von Mehmet Murat Somer, Esmahan Aykol und Perihan Mağden erfährt man weniger über das historische Istanbul, aber einiges über die lebendige, junge Subkultur der Kulturhauptstadt 2010. Als erstes bin ich mit M. M. Somer verabredet, einem Krimiautor. Sein Held ist ein transsexueller Nachtclubbesitzer. Audrey Hepburn-Doppelgängerin einerseits, harter Kerl mit Kampfsportausbildung andererseits, klärt er Verbrechen in Istanbul auf. Sein Schöpfer ist ein offen schwul lebender Ex-Banker, der mit seinen Transenkrimis nun als Schriftsteller sehr erfolgreich ist – nicht gerade das, was man von türkischer Literatur erwartet, oder? Somer hat mich zum Taksimplatz bestellt. Vom Büyük Londra im In-Viertel Beyoğlu muss ich nur einmal um die Ecke biegen, eine dunkle, steile Gasse hinuntergehen, und treffe auf die Lebensader Beyoğlus, die İstiklal Caddesi. Ein atemberaubender Moment. Es fühlt sich an, als wäre ich bisher auf einem ruhigen kleinen Bach entlanggepaddelt, der jetzt in einen reissenden Fluss mündet. Plötzlich Leben, Lärm, Lichter, ein unwiderstehlicher Sog. Wie eine Welle schlägt diese Straße abends um 18 Uhr über einem zusammen, man wird mitgerissen, alles fliesst. Die İstiklal Caddesi, die "Straße der Unabhängigkeit", ist eine autofreie Einkaufsmeile. "Verkehrsberuhigt" wäre definitiv das falsche Wort, denke ich, während ich mitschwimme. Es geht bergan, immer voller und wimmelnder wird die İstiklal. Eine deutsche Innenstadt kurz vor Weihnachten kommt einem gegen diesen Ameisenhaufen wie ein langweiliges Naherholungsgebiet vor. Und dann fährt mittendurch auch noch die bimmelnde Trambahn. An einen Ameisenhaufen fühlte sich übrigens schon Gustave Flaubert erinnert, als er Mitte des 19. Jahrhunderts Istanbul besuchte. Endstation: Taksimplatz. Vielleicht das Herz der Stadt, sicherlich das Herz Beyoğlus. Ich würde es ja das Auge des Orkans nennen, aber darin ist es bekanntlich still. Der Taksim dagegen brodelt. An dessen Rand sitzt Mehmet Murat Somer auf der Terrasse des Café Kitchenette im feinen Marmara-Hotel. Wie in einer Oase. Dies sei sein Büro, sagt der elegante Brillenträger, und raucht eine seiner leichten Zigaretten. Von hier aus könne er Beobachtungen anstellen, ohne sich einzumischen. Mehr braucht er nicht, um für seine Bücher zu recherchieren. Falls man das überhaupt so nennen kann. "Mein Istanbul ist sehr begrenzt", sagt er. "Wenn Sie einen Zirkel auf dem Taksimplatz ansetzen und einen Kreis von 500 Metern ziehen – das ist mein Istanbul. Ich bin wie ein Autist, da gehe ich nicht heraus. Alles muss zu Fuss zu erreichen sein, den Rest kenne ich gar nicht. Ich nehme keine Einladungen an, wenn die Party woanders stattfindet. Wenn Ihr mich sehen wollt, kommt zum Taksim, sage ich immer. Mein Istanbul ist die alte Halbinsel, wo das Topkapi und so liegt, und diese Gegend hier. Um den Rest kümmere ich mich nicht". Beyoğlu ist zwar tatsächlich das Zentrum des Istanbuler Nightlife. Hier gibt es die meisten Clubs und Diskotheken. Auf dem glatten Pflaster stöckeln auffällig viele Transvestiten herum. Genau wie im "XLarge", der versteckt liegenden Schwulendisco in einem ehemaligen Kino, in dessen prachtvollem Kuppelsaal ausschließlich türkische Popmusik läuft, und wo Männer, Frauen und alle anderen miteinander feiern. Doch der Club, den Mehmet Murat Somer zum Mittelpunkt seiner Romane macht, existiert nirgendwo. Er sei schließlich Romancier und nicht Autor von Sachbüchern, sagt er mit einer wegwerfenden Handbewegung. Nichtsdestrotz erzählen seine Romane von einer blühenden Undergroundszene – wobei die Kriminalhandlung beinahe nebensächlich ist. Zwei der sechs Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden[2], und als westlicher, durchschnittlich vorurteilsbeladener Leser erfährt man staunend von der langen Tradition und dem hohen Ansehen, die die "Mannmädchen" in der Machogesellschaft der Türkei genießen. Allerdings, gibt Mehmet Murat Somer zu, sei seine Version der Schwulenszene eine bewusst idealisierte: "Sehen Sie sich Schwule und Transen im Film an. Entweder lacht man über sie wie in 'Ein Käfig voller Narren', oder sie sind gefährliche Kranke, denen alles zuzutrauen ist, wie der Mörder im 'Schweigen der Lämmer'. Ich wollte einen sympathischen, positiven Helden schaffen". Und ausserdem, fügt der pragmatische Geschäftsmann hinzu, habe es in der gesamten Kriminalliteratur zwar schon einige schwule und lesbische, aber noch keinen einzigen transsexuellen Detektiv gegeben... Auch Esmahan Aykol, Jahrgang 1970, schreibt ihre Bücher hier in Beyoğlu, auch sie bewegt sich freiwillig nicht aus ihrem Viertel heraus. Doch im Gegensatz zu M. M. Somers Romanen kann man ihre Istanbul-Krimis[3] durchaus als literarische Reiseführer benutzen, Insidertipps inklusive: "Das Café Kaktüs ist einer der wichtigsten Orte Istanbuls. Alle kennen sich. Die Stammgäste sind Journalisten, Schriftsteller, Werbeleute" heisst es in Aykols erstem Roman "Hotel Bosporus". Hier treffe ich die sehr gut deutsch sprechende Autorin, die noch bis vor kurzem in Berlin lebte. Das Kaktüs liegt in einer Seitengasse der İstiklal. Und ist, ehrlich gesagt, eine einzige Enttäuschung. Der Szeneladen muss so ziemlich das unscheinbarste Lokal in ganz Beyoğlu sein. Ein winziger Raum mit vergilbten Tapeten, einigen Schwarz-Weiss-Fotos und ein paar blinden Spiegeln an den Wänden. Kein Vergleich zu den teils original erhaltenen Art Déco Restaurants rundherum. Im Kaktüs sitzt Esmahan Aykol, um zu schreiben und Freunde zu treffen. Und wenn sie nicht hier anzutreffen ist, dann im Museumscafé des Istanbul Modern. Das Museum für moderne Kunst ist von ihrer Wohnung noch fußläufig zu erreichen – Aykol weigert sich, Busse oder Taxis zu benutzen - und besticht mit einem dieser grandiosen Blicke aufs Meer, die Istanbul zu hunderten zu bieten hat. Ebenso wie ihr Kollege lässt Aykol in ihren Büchern Gegensätze aufeinanderprallen, was zu überraschenden Perspektiven führt. Ihre Heldin ist Kati Hirschel, deutsche Besitzerin eines Krimibuchladens in der Nähe des Galataturms in Beyoğlu und Hobbydetektivin. "Es musste eine Deutsche sein", sagt die Schriftstellerin, "weil ich die Aussensicht auf die türkische Gesellschaft haben wollte". Ihre Romane sind Kult in der Türkei. Weil sie deutsche und türkische Klischees mit viel Humor gegenüberstellt, und wohl auch wegen der ungewöhnlich offen geschilderten Sexszenen. Hat sie jemals Ärger dafür bekommen, oder auch für die unterschwellige Kritik an der türkischen Gesellschaft? "Nein", sagt Aykol lachend, "wenn ich sowas in einer Zeitung schreiben würde, vielleicht. Aber Bücher nimmt man hier nicht so ernst." Auf der Fahrt zu meiner dritten Verabredung wünsche ich mir, Esmahan Aykols, beziehungsweise Kati Hirschels Touri-Tipps ernster genommen zu haben. "Was glaubst du, wie die Istanbuler Taxifahrer sind? Wenn du ihnen nur den Namen der Straße sagst und nicht, wie die Moschee, die Polizeiwache oder das Krankenhaus an der nächsten Ecke heisst, kommst du in Istanbul keinen Meter weiter", warnt Kati Hirschel eine deutsche Freundin in "Hotel Bosporus". Ich sitze seit einer geschlagenen Stunde in einem Taxi nach Arnavutköy, dem alten griechischen Viertel, in dem Perihan Mağden lebt. Inzwischen telefoniert der Fahrer mit meinem Handy mit der Schriftstellerin, die ihn durch die abendliche Rush Hour zu ihrem Haus dirigiert. Dem Fahrer steht der Schweiss auf der Stirn. Das liegt nicht nur an dem katastrophalen Stau, in dem wir stecken, sondern vermutlich auch an Perihan Mağdens energischem Ton. Die 50jährige redet wie ein Schnellfeuergewehr, ob auf türkisch oder englisch, sie ist ein Star in der Türkei, eine berühmt-berüchtigte politische Kolumnistin und gefeierte Schriftstellerin. Im März ist ihr neues Buch bei uns erschienen, "Wovor wir fliehen". Bekannt wurde sie in Deutschland allerdings mit dem Roman "Zwei Mädchen. Istanbul Story"[4]. Die Geschichte von Behiye und Handan, zwei sehr unterschiedlichen Teenagern, die einen Ausbruchsversuch wagen. Tag und Nacht ziehen sie durch den Moloch Istanbul. Doch nicht die Stadt wird hier porträtiert – auch wenn sie allgegenwärtig ist -, sondern Perihan Mağden lotet die psychischen Untiefen der beiden Heranwachsenden aus. Die rebellieren 19 Tage lang gegen die Erwachsenenwelt, laufen Amok gegen die Rollen, die ihnen zugedacht werden. Das wird tödlich enden. Ebenso wie "Wovor wir fliehen", worin eine Mutter und ihre Tochter vor etwas wegrennen, das lange im Dunkeln bleibt. Dennoch passen Mağdens Romane nicht in die Krimi-Schublade. Sie sind differenzierter, komplizierter. Genau wie Perihan Mağden selbst, bei der ich irgendwann tatsächlich ankomme. Sie hatte sich geweigert, nach Beyoğlu zu kommen, sie ertrage das Gewimmel von 17 Millionen Menschen nicht mehr. Statt dessen sieht sie sich Istanbul von hier aus an, und das lohnt sich. Von ihrem Schreibtisch im ersten Stock ihres Hauses blickt sie über das Dach einer christlich-orthodoxen Kirche hinweg auf die Bosporusbrücke. Die Stadt liegt ihr zu Füßen. Ihr und ihrer 17jährigen Tochter Melek, mit der sie hier lebt. "Istanbul bedeutet für mich Mutterstadt", sagt Mağden. Ihre Mutter, ihre Großmutter und deren Großmutter lebten hier, sie könne sich nicht vorstellen, irgendwoanders zu wohnen, schon gar nicht in der Türkei. Aber die Stadt hat auch ihre Probleme mit Perihan Mağden, denn wenn sie gerade keine Romane schreibt, dann verwandelt sich die fröhliche, oft lachende Frau wieder in das political animal, das sie auch ist, und wütet in der Zeitschrift "Radikal" aggressiv und mit schneidendem Witz gegen alles, was ihr am türkischen Staat verhasst ist: Ungerechtigkeiten in der Justiz, die Korruption, das Militär, den Krieg gegen die Kurden. Mindestens drei Prozesse laufen zur Zeit gegen sie. "Manchmal denke ich: Steckt mich doch endlich ins Gefängnis, bringen wir's hinter uns! Aber das tun sie nicht. Ich bin berühmt, die internationale Presse würde hier Schlange stehen, das wäre denen zu peinlich", sagt sie und lacht schadenfroh. Im Moment hat die Stadt noch Ruhe vor ihr. Denn Perihan Mağden schreibt wieder an einem Roman, und wenn sie das tut, zieht sie sich immer aus dem tagespolitischen Geschäft zurück. Und lässt statt dessen ihre Figuren gegen die Begrenzungen der Gesellschaft anrennen. Dieses Mal wird es keine Frauengeschichte, sondern ein Roman über ein schwules Paar. Er beruht auf einer wahren Geschichte, einem Kriminalfall aus der Istanbuler Subkultur der 90er Jahre. Es lohnt sich, die alte, junge Stadt von dieser Warte zu betrachten, einzutauchen ins Getümmel, sich die eigenen Erwartungen und Stereotypen durcheinanderwirbeln zu lassen. Die Subkultur öffnet den Blick für alles, was jenseits der Reiseführerklischees liegt. Was ich zum Beispiel überhaupt nirgends gespürt habe, ist der berühmte "Hüzün", die leicht melancholische Stimmung, die hier angeblich herrscht. Nicht, dass es sie nicht tatsächlich gäbe – ich habe sie nur in dem fröhlichen Gewühl Beyoğlus nicht finden können. Oder doch? Wer weiss, vielleicht leidet ja der maunzende Graupapagei im Büyük Londra darunter...
[1] Orhan Pamuk: "Istanbul. Erinnerungen an eine Stadt", erschienen bei Hanser [2] Mehmet Murat Somer: "Die Prophetenmorde" und "Der Kussmord", beide im Tropen-Verlag erschienen [3] Esmahan Aykol: "Hotel Bosporus", "Bakschisch", "Scheidung auf türkisch", alle bei diogenes erschienen [4] beide bei Suhrkamp erschienen erstmals erschienen im BÜCHER Magazin, 2010 Comments are closed.
|



 RSS Feed
RSS Feed